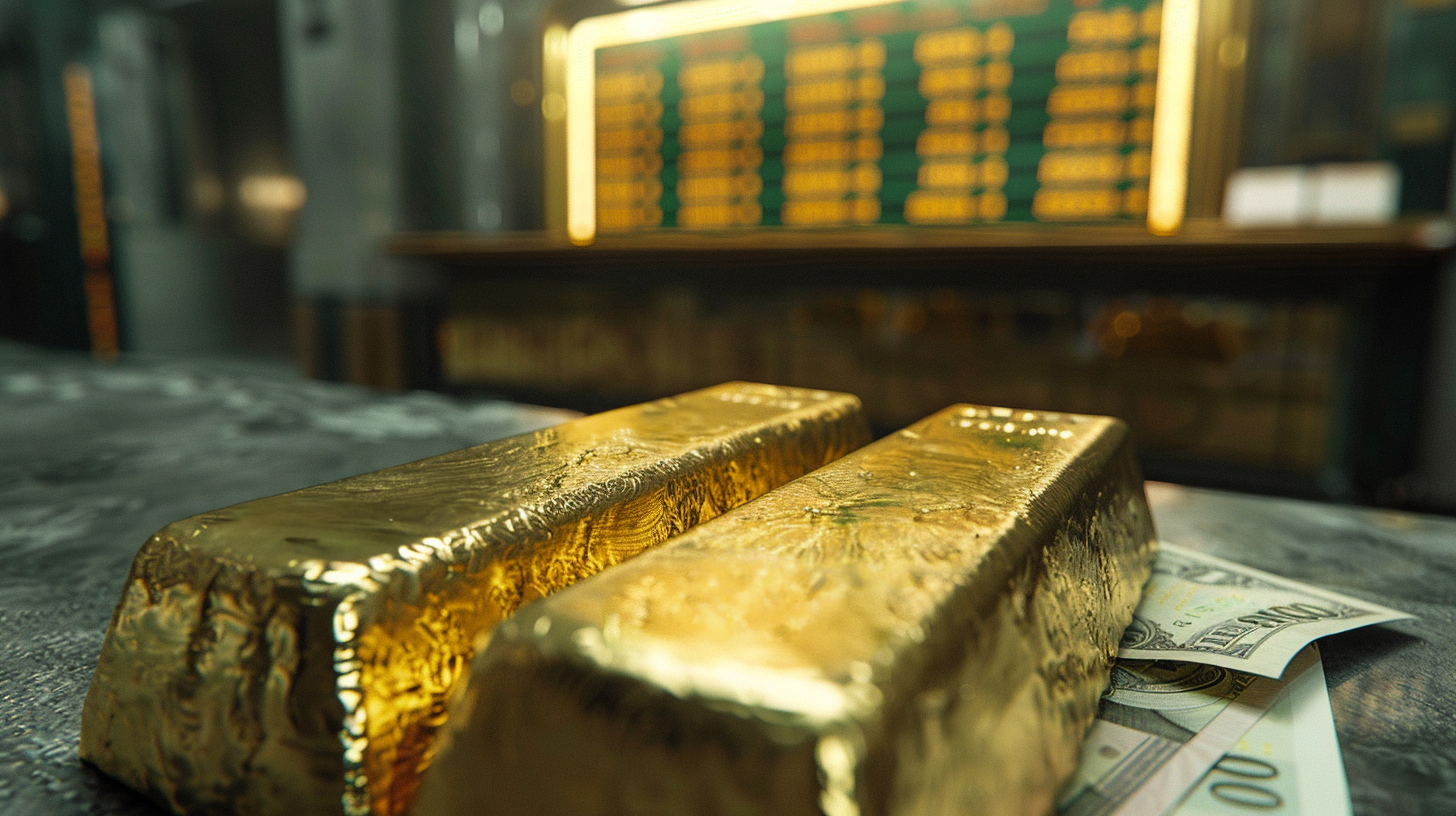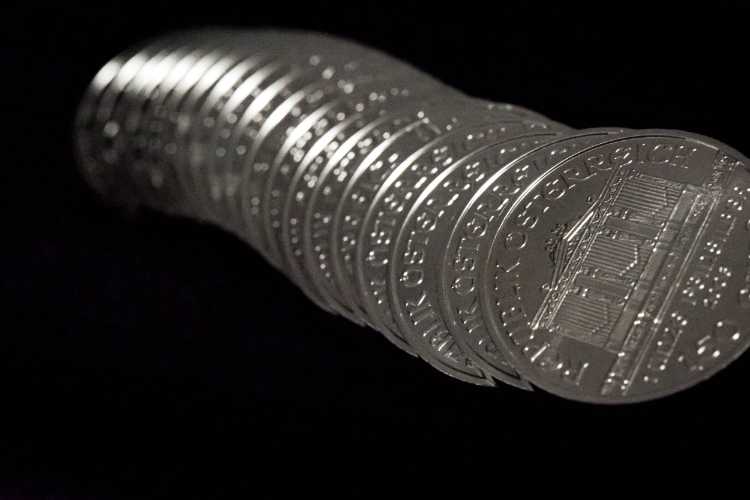Rückblick auf die Goldpreis-Entwicklung im 1. Halbjahr 2025
Der Goldpreis hat im ersten Halbjahr 2025 eine außergewöhnliche Rally hingelegt. Von rund 2.630 US‑Dollar je Feinunze Anfang Januar kletterte er zeitweise auf mehr als 3.300 Dollar – ein Plus von etwa 26 Prozent in US‑Währung. In Euro fiel der Anstieg mit rund 12 Prozent moderater aus, weil der US‑Dollar im Jahresverlauf deutlich nachgab. Damit setzte Gold nicht nur seine Aufwärtsbewegung aus dem Vorjahr fort, sondern markierte im ersten Halbjahr gleich 26 neue Allzeithochs.
Was ist in den vergangenen Monaten geschehen?
- Immer mehr Staaten, insbesondere jene die der BRICS-Staatengemeinschaft nahestehen, reduzierten ihre Abhängigkeit vom US-Dollar als Reservewährung (De-dollarisierung).
- Das führte zu einer großen staatlichen Goldnachfrage in Form weltweit steigender Goldreserven.
- Die US-Inflation ist zwar nach der Hochphase im Jahr 2022 deutlich gesunken, sie blieb aber über dem von den Zentralbanken anvisierten Niveau und stieg zuletzt sogar wieder an (2,7 % im Juli 2025).
- Im Dezember 2024 senkte die US-Notenbank letztmalig die Leitzinsen (auf 4,25 bis 4,50 Prozent), erst für September 2025 war der nächste Schritt erwartet worden. Die EZB legte im Juli eine Zinssenkungspause ein (bei 2,00 Prozent).
- Auch die zunehmenden geopolitischen Spannungen, vor allem mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine und dem eskalierten Nahostkonflikt förderten den finanziellen Absicherungsbedarf, auch unter staatlichen Entitäten.
Zusammengefasst: Getrieben wurde die stabile Goldpreis-Entwicklung von einer Mischung aus starker Investmentnachfrage, fortgesetzten Zentralbankkäufen und einem fragilen weltwirtschaftlichen Umfeld. Die geopolitischen Spannungen – von den Handelskonflikten zwischen den USA und ihren Partnern bis zu anhaltenden Krisenherden im Nahen Osten – hielten das Sicherheitsmotiv der Anleger hoch. Auch die Erwartungen an eine Lockerung der Geldpolitik in den USA verstärkten den Kaufdruck. Sinkende oder stagnierende Anleiherenditen machten das zinslose Edelmetall im Vergleich attraktiver.
Ausblick & Prognose 2025
Im Vergleich zu anderen Anlageklassen zählte Gold im ersten Halbjahr zu den klaren Gewinnern. Zwar legten auch Aktienindizes wie der S&P 500 und Rohstoffe wie Platin kräftig zu, doch die Stabilität und Krisenresistenz des Edelmetalls überzeugte vor allem langfristig orientierte Anleger.
Wie geht es im Jahr 2025 für Gold weiter? Seit Anfang April folgt der Goldpreis einer ausgedehnten Seitwärtsbewegung. Dies ist einerseits Ausdruck fehlender Impulse und einer Wartehaltung auf dem Goldmarkt. Andererseits zeigt sich darin auch eine anhaltende Goldstärke, das Edelmetall fand bei Rücksetzern schnell wieder Käufer. Wie stehen die Chancen auf eine neue Rekord-Rally?

US-Dollar
Schwacher US-Dollar, bedeutet starkes Gold – und umgekehrt. Steigende Zinsen in einem Land können eine Währung im Wettbewerb vorübergehend aufwerten – und umgekehrt. Das ist erkennbar an entsprechenden Wechselkursbewegungen, z.B. Euro-Dollar-Kurs.
Allerdings sehen wir seit Jahrzehnten die systematische Verwässerung der Kaufkraft von Dollar, Euro und Co. durch steigende Verschuldung und Inflationierung. Am Ende wertet alles Geld gegen Gold ab, was sich in einem kontinuierlich steigenden Goldpreis ausdrückt.
Was kann den Dollar kurzfristig stärker? Substanzielles Wirtschaftswachstum und stagnierende oder wieder ansteigende Zinsen beispielsweise. Danach sah es zuletzt nicht aus. Aber auch in einer ernsten Krise kann die Nachfrage nach Dollar kurzfristig steigen.
Welche Faktoren führen zu einer Dollar-Schwächung? Sinkende Zinsen oder eine Rezession beispielsweise. Oder weltpolitisch: Die zunehmende Abkehr großer Volkswirtschaften oder Staatenverbände vom Dollar als Handels- und Reservewährung, etwa wie wir es bei den BRICS-Staaten sehen.
Kurz: Alles was den US-Dollar 2025 vorübergehend stärkt, wirkt sich tendenziell negativ auf den Goldpreis aus – und umgekehrt. Langfristig darf man eine Fortsetzung der Abwertung des Dollar gegenüber Gold zu erwarten.

Inflations- und Zinserwartungen
Die Zentralbanken stecken in einer Zwickmühle. Die Inflation näherte sich zuletzt wieder der Marke von 3 Prozent. Kommt die Wirtschaft gleichzeitig nicht in Schwung, herrscht Stagflation. Präsident Donald Trump schuf mit seiner Wirtschaftspolitik in der zweiten Amtszeit womöglich mehr Probleme, als er gelöst hat. Der große Konjunkturaufschwung ließ Mitte 2025 noch auf sich warten.
Die aggressive Zollpolitik schlägt sich in steigenden Preisen auch im eigenen Land nieder – besonders in einer konsumabhängigen Volkswirtschaft wie den USA. Es ist wahrscheinlich, dass Trump den Druck auf die US-Notenbank hochhalten wird.
Er benötigt günstige geldpolitische Rahmenbedingungen – im Zweifel auf Kosten höherer Inflationsraten. Niedrige Zinsen sind aus seiner Sicht nötig, um Investitionen zu fördern und die steigende Staatsverschuldung tragbar zu machen. Neuinvestitionen in fossile Energieträger, wie Trump sie bevorzugt, könnten die Energiepreise dämpfen – jedoch zulasten der Umwelt.
Kurz: Niedrige Zinsen, steigende Schulden und eine anhaltende Inflation sind Faktoren, die mittel- bis langfristig für einen höheren Goldpreis sprechen.

Geopolitische Spannungen und Krisen
Geopolitische Spannungen und Kriege, wie in der Ukraine und im Nahen Osten, zwischen den USA und China sorgen immer wieder für Unsicherheiten an den Märkten. Solche Krisen und deren Eskalation wirken sich in der Regel nur kurzfristig direkt auf den Goldpreis aus.
Allerdings gibt es immer mittel- und langfristige Effekte. Dies äußerte sich in einer stärkeren nationalen Goldnachfrage, oft steigenden Energiepreisen, höherer Schuldenaufnahme und damit auch auf die Inflation aus.
Auf der anderen Seite kann es den Goldpreis kurzfristig belasten, sollte sich ein Ende des Krieges in der Ukraine abzeichnen. Denn Investoren könnten ihre Risikoneigung erhöhen und Geld aus defensiven Werte wie Gold abziehen. Doch Mitte 2025 nahmen die Spannungen eher zu – insbesondere zwischen den USA und Russland.
Kurz: Eine De-Eskalation geopolitischer Krisen wie Trump sie ursprünglich anstrebte, hat bislang nicht stattgefunden. Es könnten sogar neue Brandherde entstehen – China hat nach wie vor großes Interesse an Taiwan. Der Goldpreis profitiert auch von dieser Art der Unsicherheit.

Private Goldnachfrage
Gold wird nicht nur in schlechten Zeiten gekauft, sondern auch dann, wenn es den Menschen wirtschaftlich besonders gut geht. Dieser Aspekt trifft vor allem auf die indische Schmuckfrage zu. Jahrzehntelang bildete diese physische Goldnachfrage einen bedeutenden Goldpreis-Faktor.
Allerdings war dieser Einfluss in den vergangenen Jahren rückläufig. Auch in China ging die Schmucknachfrage aufgrund des starken Goldpreis-Anstiegs zurück.
Die Kaufkraft auf dem indischen Goldmarkt hängt wesentlich von den Erträgen der Landwirtschaft ab. Man schätzt, dass rund 60 Prozent der indischen Goldnachfrage von Farmern ausgeht, die mit Gold ihr Einkommen absichern. In der Türkei gibt es ein ähnliches Sparverhalten, im Bewusstsein der traditionell hohen türkischen Inflation.
Kurz: Steigender Wohlstand in den Schwellenländern fördert auch die dortige, physische Nachfrage. Doch der hohe Goldpreis dämpfte zuletzt diesen preissensiblen Markt.
Im Auge behalten: Die Zahlen zu den Schweizer Goldimporten nach Indien und China geben immer wieder Auskunft über die Nachfrageentwicklung in diesen wichtigen Goldländern. Die Schweiz bedient bis zu zwei Drittel der weltweiten Nachfrage nach verarbeitetem Gold.

China und die Schwellenländer
Die Goldnachfrage Chinas war ein wesentlicher Faktor für den starken Goldpreis-Anstieg im Jahr 2024. Abzuwarten ist, ob es neue Impulse gibt. Schließlich sanken die Goldkäufe Chinas in den vergangenen Monaten infolge des anziehenden Goldpreises.
Was sind die politischen Motive Chinas auf dem Goldmarkt? Hier einige wichtige Faktoren, die auch in vielen Schwellenländern von Bedeutung sind:
- Diversifizierung der Währungsreserven: Durch den Ausbau der Goldreserven reduziert China seine Abhängigkeit vom US-Dollar und strebt eine stabilere und sicherere Reservebasis an.
- Stärkung der Landeswährung: Die Erhöhung der Goldreserven soll das Vertrauen in die Landeswährung stärken und deren internationale Nutzung fördern.
- Absicherung gegen geopolitische Risiken: In Zeiten globaler Spannungen bietet Gold einen sicheren Hafen, um wirtschaftliche und politische Unsicherheiten abzufedern.
- Schutz vor Inflation: Gold dient als Inflationsschutz und hilft, den Wert der nationalen Vermögenswerte zu bewahren.
- Währungsaspekt: Gold kann als (von den USA) unabhängige Handelswährung dienen oder als Basis zum Aufbau einer mit Gold gedeckten Währung.
Kurz: Die kommende Goldpreis-Entwicklung hängt auch davon ab, wie stark die chinesische Goldnachfrage gemäß der genannten Bedürfnisse ausfällt. Aber China kauft nicht zu jedem Preis.
Im Auge behalten: Die Goldpreis-Aufschläge in Shanghai und die chinesischen Goldimporte

Crash-Gefahr
Überraschungen sorgen an der Börse für die dynamischsten Kursbewegungen.
Die Rally an den Börsen war bis zuletzt auch von einem hohen Aufkommen an Finanzvermögen getrieben. Es floss viel spekulatives Geld in Aktien, die mit KI-Technologien in Verbindung stehen. Aber auch der Bitcoin-Kurs legte stark zu.
So spiegelte die positive Entwicklung an den Aktienmärkten nicht in erster Linie herausragende Konjunkturaussichten wider. Ein Großteil der Rally lässt sich auf das schiere Vorhandensein hoher Liquidität zurückführen, die sich ihren Weg in möglichst renditereiche Anlageformen suchte.
Aber was geschieht, sollten sich die Kursübertreibungen einmal in einer Korrektur auflösen, oder sogar in einem Crash?
Aus der Vergangenheit wissen wir, dass in einer Marktpanik oft sichere Häfen gesucht sind. In einer ersten Crashwelle waren aber häufig zunächst US-Dollar gefragt. Denn Cash ist in dieser Phase „King“. Dagegen werden gut gelaufene Vermögenswerte im Run auf Liquidität abgestoßen. Erfahrungsgemäß kann auch Gold in einem solchen Umfeld unter die Räder kommen, etwa wie im Zuge der Weltfinanzkrise von 2008.
Der große Goldpreis-Anstieg kam dann mit Verzögerung, als Regierungen und Zentralbanken die Symptome der Krise mit praktisch unbegrenzter Liquidität und neuer Schuldenaufnahme bekämpfen mussten. Allerdings kann niemand ein solches Crash-Szenario minutiös vorhersehen – auch nicht den letztlichen Grund oder Auslöser einer Panik. Man sollte die Zusammenhänge aber stets im Hinterkopf behalten.
Zusammenfassung
Ein schwächerer Dollar, getrieben durch sinkende Zinsen oder Rezessionen, könnte den Goldpreis im Verlauf des Jahres 2025 weiter stützen. Geopolitische Krisen und Unsicherheiten wirken langfristig oft preistreibend, während ein Rückgang solcher Spannungen den Preis dämpfen könnte.
Chinas Goldnachfrage und staatliche Goldkäufe bleiben ein wichtiger Faktor, die durch Währungsdiversifikation, Inflationsschutz und geopolitische Absicherung getrieben werden. Auch steigender Wohlstand in Schwellenländern kann neben dem Aspekt der privaten Vermögensabsicherung die private Goldnachfrage befeuern.
Ein Crash-Szenario könnte zunächst zu einem Dollaranstieg führen, bevor Gold von liquiditätsgetriebenen Maßnahmen profitiert. Langfristig dürfte die Abwertung von Währungen gegenüber Gold weitergehen.
Goldprognosen
Welche Kursentwicklung prognostizieren Finanzmarkt-Profis?
Die London Bullion Association (LBMA) hat ihre Goldpreis-Prognose für 2025 deutlich angehoben. Der erwartete Durchschnitt liegt nun bei 3.159 US-Dollar pro Unze, über 15 Prozent höher als im Januar geschätzt. Kein Analyst rechnet mit einem Jahresmittel unter 3.000 Dollar. Haupttreiber sind geopolitische Krisen, neue US-Zölle und Sorgen um die US-Haushaltslage. Zum Jahresende wird im Schnitt ein Preis von 3.324 Dollar erwartet.
Von Incrementum kommt erneut eine fundierte Goldmarkt-Analyse. Bereits frühere Prognosen von Ronald-Peter Stöferle und Mark J. Valek wirkten ambitioniert – doch die Stärke der jüngsten Rally bestätigt das große Goldpreis-Potenzial. Laut dem Juli-„Gold Compass“ des Kapitalverwalters sind bis 2030 im Basisszenario 4.822 US-Dollar und im inflationären Szenario sogar 8.926 US-Dollar möglich.
Die Schweizer UBS erwartet den Goldpreis bis Jahresende bei 3.500 US-Dollar, mit Aufwärtspotenzial bis 3.800 US-Dollar bei steigenden geopolitischen oder wirtschaftlichen Risiken. Die Bank prognostiziert für 2025 die höchste Gesamtnachfrage seit 2011 und empfiehlt eine mittlere einstellige Gold-Quote im Portfolio.
Aber, es gibt für die zweite Jahreshälfte auch verhaltene bis negative Prognosen: Citi erwartet im 3. Quartal 2025 eine Goldpreis-Konsolidierung zwischen 3.100 und 3.500 US-Dollar. Geopolitische Entspannung und ein besserer Wirtschaftsausblick hätten das April-Hoch bei 3.500 Dollar bereits gedeckelt. Das kurzfristige Ziel wurde Mitte Juni auf 3.300 Dollar gesenkt. Ab 2026 rechnet Citi mit 2.500–2.700 Dollar wegen nachlassender Investmentnachfrage. Die Bank lag mit ähnlichen Prognosen in der Vergangenheit mehrfach richtig.
Die britische Investmentbank HSBC hat die Goldpreis-Prognose für 2025 auf 3.215 US-Dollar angehoben, bleibt aber vorsichtig. Ein höheres Angebot und sinkende physische Nachfrage, etwa bei Schmuck und Münzen, könnten die Rally bremsen. Kurzfristig sind zwar noch Anstiege möglich, doch ohne starke geopolitische Impulse fehlt eine tragende Nachfragebasis. Langfristig stützten geopolitische Spannungen, Handelskonflikte und ein schwacher Dollar – doch die Luft nach oben werde aber dünner.

Anlagestrategie 2025
Wer sein Vermögen langfristig absichern möchte oder sich noch im Vermögensaufbau befindet, sollte weiter regelmäßig und konsequent in physisches Gold investieren. Rücksetzer können zu Nachkäufen genutzt werden. Ein Goldanteil von 20 Prozent am liquiden Vermögen ist im aktuellen Umfeld eher eine defensive Empfehlung – 20 Prozent des Gesamtvermögens in Gold ist dagegen ein ordentliches Statement. Wer spekulativ investieren möchte, sollte Risiken im Blick behalten.
Wichtig ist aber auch eine breite Streuung des Vermögens. Man weiß nie was kommt. Also niemals alles Geld auf eine Karte setzen – so sind sie auch für das kommende Jahr gut aufgestellt. Wer spekulativ investieren möchte, sollte Risiken im Blick behalten.